Das Cringe-Forschungsteam traf sich im neuen Jahr, um das Einleitungskapitel von Margaret Wetherells Affect and Emotion und Lea Schneiders Arbeit über Radikale Verletzbarkeit in der Gegenwartsliteratur miteinander zu besprechen.
Wetherell: Introducing Affect
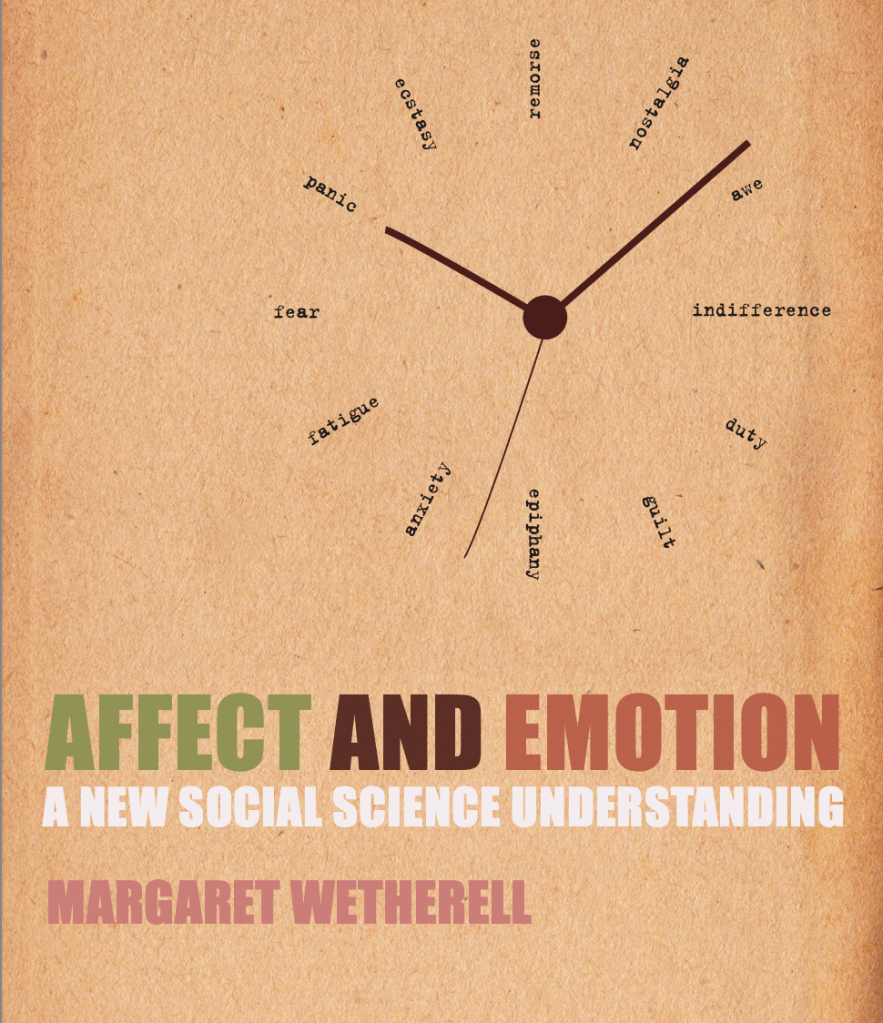
In Wetherells Arbeit kristallisiert sich, dass das Forschen zu Affekten hilfreich ist beim Einordnen und Neudenken ambivalenter Gefühlszustände, wie etwa „enjoyable melancholy“ oder „intense indifference“ (S. 2) – oder, wie wir finden, cringe. Fortschreitend wird dem Leser eine Methode für das Neudenken („new ways of thinking“) vorgeschlagen, das ihrer Meinung nach notwendig ist, um losgelöst von derzeitigen Konventionen der Evidenz basierten und kritischen Diskursanalyse hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz führt: die affektive Praxis („affective practice“, S. 4).
Affective practice focuses on the emotional as it appears in social life and tries to follow what participants do. It finds shifting, flexible and often over-determined figurations rather than simple lines of causation, character types and neat emotion categories (S. 4).
Affekt ist, laut Wetherell, „embodied meaning-making“ und eine inherent menschliche Emotion (S. 4), wobei sich für uns ihr Fokus auf den Einbezug des Körpers ganz besonders heraushebt, da sich unsere soziolinguistische Forschung viel mit der Versprachlichung der Körperlichkeit von Affekten beschäftigt. Auf Seite 10 wird ihr Fokus noch etwas deutlicher, wenn sie schreibt: „Above all else, it is clear that coming to terms with affect implies coming to terms with the body“.

Als beispielhafte Affekte beschreibt Wetherell unter anderem die Dancing Epidemic aus dem Strasbourg des 16. Jahrhunderts. In einem Zeitraum von wenigen Monaten waren hunderte Einwohner des Elsass von einem ‚Tanzfieber‘ eingenommen, das ihre Körper scheinbar gegen ihren Willen bis zur Erschöpfung in tänzerischer Manie bewegte. Auch wenn die genauen Ursachen bis heute unklar sind, geht man von einer Stress induzierten Massenreaktion auf unzumutbare Lebenssituationen aus. Was einige dieser Menschen auf bizarre und höchst ambivalente Weise in ihren eigenen Tod tanzen ließ, lässt sich mit gängigen Emotions-Modellen schwer bis gar nicht begreifen. „Yet something was felt. Bodies became organised and a situation was formualted, evaluated, negotiated and, crucially, communicated“, so Wetherell (S. 5). Konkret muss die affective practice demnach somatische, neuronale, subjektive, historische, soziale, wie auch persönliche Aspekte sinnvoll miteinander vereinen (S. 11), um das Neudenken von ambivalenten Affekten zu ermöglichen.
Zuvor wurde Affekten oft ein chaotischer, disruptiver Charakter zugesprochen – turbulent und spontan auftretend. Doch Wetherell argumentiert, dass Affekten sehr wohl eine gewisse Ordnung und Organisation inne ist (S. 13 f.). Es herrschen Muster vor in etwa den Reaktionen der Amygdala, wie und warum sich unser Puls erhöht, welche Gedanken damit einhergehen, wie Beziehungen damit verwoben sein könnten. Je nach affective practice sind es unterschiedlich viele Schichten von Mustern, die zusammenspielen. Manchmal sind sie individuell, andere Male jedoch untrennbar mit sozialen Praktiken verstrickt. In unserer Forschungsgruppe stellte sich die Frage, ob man das wort „practice“ aus dem Englischen nur als ‚Praktik‘, oder eben auch aus ‚Übung‘ übersetzen müsste, denn in manchen Fällen ähnelt das Aneignen einer solchen affective practice nicht nur einem Ausüben, sondern auch einem Einüben, und danach einem Performen.
Die Muster, die sich unter einem Affekt verbergen, sind keineswegs automatisch oder statisch, sondern beinhalten etwas aktives und fließendes. Wetherell nimmt als Metapher das sorgfältig durchdachte Zusammenstellen eines Werkzeugkastens, in dem die Werkzeuge so sinnvoll wie möglich zueinander beschafft und ausgerichtet werden, aber möglicherweise auch fehlen oder fehlerhaft sind. Der Inhalt des Werkzeugkastens kann sich ständig rekonfiguieren und weiterentwickeln, und die Zusammenstellung kann frei oder vorgegeben sein, sowie alles dazwischen. Auch wenn Muster bestehen, kann ihr Aufdröseln aufgrund der Komplexität der Zusammenspiele und Prozesse ein unmögliches Vorhaben darstellen (S. 15 f.).
Abschließend für unsere Diskussion wurde in Wetherells Text, ähnlich wie in Ahmeds „The cultural politics of emotion“, auf das Zusammenspiel von Macht und Affekten eingegangen.
Power works through affect, and affect emerges in power (S. 16).
Sie stellt einige Fragen auf, mit der sich auch unsere Foschung beschäftigt: Wer darf eigentlich wann, was, machen? Welche Beziehungen werden von affective practices gepflegt, gestärkt, gebildet oder gestört? Wer ist emotional im Vorteil, wer im Nachteil? Und wie sehen diese Vorteile beziehungsweise Nachteile aus?
Spannende Fragen, die mit Lea Schneiders Arbeit über Radikale Verletzbarkeit vielleicht ein wenig beleuchtet werden können. Wir lasen gemeinsam das zweite Kapitel: »Because Internet«.

In diesem Kapitel beschreibt Schneider, wie die digitalen sozialen Medien mit ihren sogenannten Affordanzen radikal verletzbares Schreiben begünstigen. Sie nennt dafür 10 Gründe, unter anderem die Verschiebung von kuratorischem zu algorithmischem Gatekeeping und die Entstehung einer neuen Aufmerksamkeitsökonomie, wobei Affekte und Affizierungen eine entscheidende Rolle spielen (S. 56).
Auch wenn die Online-Räume der sozialen Medien neue Affordanzen mit sich bringen, ist es notwendig zu betonen, dass On- und Offline-Räume nicht trennbar voneinander und demnach von den selben Machtstrukturen durchzogen sind (S. 60). Nicht unwichtig ist hierbei der Fakt, dass Plattformen wie Instagram oder Twitter (bzw. ‚X‘) im Besitz von politisch einflussreichen Tech-Milliardären sind. Diese Plattformen kreierten Gewinn bringende Algorithmen, die von der Aufmerksamkeit und Partizipation der User*innen gespeist werden. Nun ist schon lange klar, dass stark affizierter Content öfter kommentiert und geteilt wird, weshalb der Algorithmus ihn bevorzugt. Hier fusioniert sich die Aufmerksamkeitsökonomie zu einer Affektökonomie („affection economy„, C. Abidin in Internet Celebrity, S. 95): „Was affiziert, interessiert, was interessiert, monetarisiert.“ (S. 64). Schneider schließt hieraus, dass das Publizieren radikal verletzbarer Texte somit Autor*innen schlicht nahegelegt wird.
Was in traditioneller Literaturvermarktung als Mangel gemessen wird, ist für diese radikal verletzbaren Texte kein Nachteil. Es erfolgt eine Aufwertung des Ungefilterten, getragen von einer Authentizitätsethik, die so etwas wie Rechtschreibfehler oder schriftliche Mündlichkeit nicht nur duldet, sondern geradezu bevorzugt. Hierbei gilt jedoch: Es handelt sich nicht um tatsächliche, wahrhaftige Authentizität. Da mit dem Posten und Publizieren immer eine Performance einhergeht, muss man hier viel eher von einem Stil oder Effekt einer Authentizität sprechen. Es kann wie ein Genre angesehen werden (S. 68).
Die Verletzbarkeit (und vielleicht auch ein gewisser Cringe?) kommt ins Spiel durch die Rückbindung des Texts an das postende Subjekt. Auf den meisten soziale Medien herrscht ein gewisser Identifikationszwang; viele Menschen sind mit Profilfotos und ihren Klarnamen registriert. Digitale Räume werden Orte der alltäglichen Identitätsarbeit für ihre Nutzer*innen (= „everyday practice“). Schneider spricht hier von einem „Intimacy Turn“, dem nach eine Erosion der Trennung zwischen öffentlichen und privaten Räumen auf Social Media Kanälen stattfindet (S. 75). Diese „ambient intimacy“ entsteht, weil man zwar ein Publikum mitdenkt, jedoch Schwierigkeiten hat, es konkret zu definieren (S. 76). Diese sorgt dafür, dass Postende sich in der Lage sehen, offensive oder beschämende Themen, die sie im Kern betreffen, und die sie unter normalen Umständen nicht öffentlich teilen würden, auf ihren Kanälen preisgeben (S. 74). Es herrscht eine „sense of intimacy within anonymity“. Die Verletzbarkeit hier besteht darin, dass die Postenden letztendlich wenig bis keine Kontrolle darüber haben, wer ihren Text liest.
Eine weitere Verletzbarkeit – und darf man sagen, cringe? – entsteht durch den „Context Collapse“ (ein Begriff von dana boyd), der durch die Fusion des öffentlichen und privaten Raums geschieht. Auf dem Instagram-Account einer Person versammeln sich im Publikum neben Freunden und Bekannten möglicherweise auch Eltern, Großeltern, Kolleg*innen, gar Vorgesetzte? Durch diesen „presence bleed“ laufen Rollenperformances, die ansonsten räumlich und zeitlich von einander abgegrenzt existieren, ineinander über. Das kann zu peinlichen und schambehafteten Momenten führen (S. 78).

Für deprivilegierte Personengruppen öffnet sich erst durch diese „ambient intimacy“ und durch die anderen vielfältigen Affordanzen der sozialen Medien die Möglichkeit, über gewisse Erfahrungen öffentlich zu sprechen und eine Zusammengehörigkeit zu kreieren. Schneider argumentiert auch, dass hinter der textuell mündlichen Authentizitätssästhetik eine gewisse strukturelle Weiblichkeit Raum und Aufmerksamkeit bekommt, die in der männlich dominierten Literaturvermarktungsszene oft keinen Halt finden kann: „to write from the position of one’s femaleness is still to commit oneself to low culture“ (Dodie Bellamy). Das Kreieren und Publizieren von radikal verletzbaren Texten kann demnach als feministische Kunstpraxis angesehen werden (S. 81).